Interview mit Martin Brandis, Experte von der Energieberatung der Verbraucherzentrale
An einem frostigen Morgen die wohlige Wärme der eigenen vier Wände genießen – für viele Hausbesitzer ist das der Inbegriff von Wohnkomfort. Damit die Heizkosten bezahlbar bleiben, sind am besten die Außenwände gedämmt. Doch was tun, wenn eine Außendämmung der Wände nicht möglich ist, etwa weil die Fassade denkmalgeschützt oder der Platz zu knapp ist? In solchen Fällen kann die Innendämmung eine sinnvolle Alternative sein. Doch worauf ist dabei zu achten? Welche Materialien eignen sich? Und wie lässt sich verhindern, dass Feuchtigkeit Schäden verursacht? Diese und weitere Fragen klären wir im Gespräch mit Martin Brandis, Energieexperte bei der Verbraucherzentrale.
Herr Brandis, warum spielt die Wärmedämmung von Außenwänden eine so zentrale Rolle bei der energetischen Sanierung von Altbauten?
Martin Brandis: Die Wärmedämmung von Außenwänden ist eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, um den Heizenergiebedarf älterer Gebäude deutlich zu senken. Und stellt gleichzeitig eine der größten Herausforderung dar: Der energetische Zustand von Altbauten entspricht häufig nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch eine Dämmung lässt sich jedoch viel erreichen – sowohl in puncto Energieeinsparung als auch beim Wohnkomfort. Im Optimalfall erfolgt die Dämmung von außen – also auf der Fassadenseite –, weil sich dabei Wärmebrücken am besten vermeiden lassen.

Eine gut gedämmte Fassade schützt vor Wärmeverlust und steigert den Wohnkomfort. Fachgerechte Dämmung ist ein wichtiger Beitrag für energieeffiziente Gebäude.
In welchen Fällen kommt denn eine Innendämmung statt einer Außendämmung infrage?
Martin Brandis: Immer dann, wenn eine Dämmung der Fassade nicht möglich ist – etwa aus optischen, technischen oder rechtlichen Gründen –, ist die Innendämmung eine Lösung. Das ist zum Beispiel bei denkmalgeschützten Fassaden der Fall, deren historisches Erscheinungsbild bewahrt werden soll. Aber auch bei Gebäuden, die sehr nah an anderen Häusern stehen oder an der Grundstücksgrenze, kann eine Außendämmung schwierig oder unmöglich sein. Und nicht zuletzt in Eigentümergemeinschaften, wenn sich keine Einigung auf eine Außendämmung erzielen lässt, haben einzelne Eigentümer die Möglichkeit, ihre Wohnung von innen zu dämmen.
Welche Vorteile bietet die Innendämmung konkret?
Martin Brandis: Der größte Vorteil ist, dass sie überhaupt möglich ist, wenn die Fassade unangetastet bleiben muss. Außerdem kann raumweise gedämmt werden – das heißt, man kann zum Beispiel mit den am stärksten genutzten Räumen beginnen. Und wie gesagt: EigentümerInnen in einer Gemeinschaft können unabhängig von den anderen handeln. Das schafft individuelle Spielräume.

Wenn eine Außendämmung nicht möglich ist, schafft die Innendämmung neue Möglichkeiten. Sie verbessert den Wärmeschutz und lässt sich flexibel in einzelnen Räumen umsetzen.
Gibt es denn auch Nachteile bei der Innendämmung?
Martin Brandis: Ja, die sollten ehrlich benannt und bedacht werden. Eine Innendämmung bringt im Vergleich zur Außendämmung einige Einschränkungen mit sich: Wärmebrücken lassen sich nicht so gut vermeiden. Es besteht zudem die Gefahr, dass sich bei fehlerhafter Ausführung in der Dämmschicht Tauwasser bildet – das kann langfristig zu Schäden führen. Deshalb ist in vielen Fällen ein feuchteschutztechnischer Nachweis erforderlich. Und nicht zuletzt verkleinert sich der Wohnraum durch die Dämmschicht geringfügig. Auch ist die Dämmwirkung meist geringer als bei Außendämmungen.
Welche Anforderungen müssen erfüllt sein, bevor mit der Innendämmung begonnen werden kann?
Martin Brandis: Bevor eine Außenwand von innen gedämmt wird, muss sichergestellt sein, dass sie trocken und gegen Feuchtigkeitseintrag geschützt ist. Sonst besteht die Gefahr, dass Feuchtigkeit in die Konstruktion eindringt – mit allen bekannten Risiken. Daher sollte vor der Umsetzung unbedingt eine bautechnische Prüfung erfolgen. Hier kann eine Energieberatung helfen, die richtigen Schritte einzuleiten.

Vor der Innendämmung lohnt sich eine fachkundige Beratung. So lassen sich Risiken vermeiden und die passenden Lösungen für das eigene Zuhause finden.
Wie ist eine Innendämmung technisch aufgebaut?
Martin Brandis: Es gibt unterschiedliche Systeme. Eine häufige Variante besteht aus einer Tragkonstruktion – meist aus Holz oder Aluminium –, in die Dämmstoffplatten oder -matten eingefügt werden. Darauf kommt eine luftdichte Dampfbremsfolie, die das Eindringen von Luftfeuchtigkeit verhindert. Den Abschluss bildet dann zum Beispiel eine Gipskartonplatte oder eine Holzfaserplatte. Alternativ kann man auch diffusionsoffene, mineralische Dämmplatten direkt auf die Innenwand kleben und anschließend verputzen – das spart etwas Platz und ist baubiologisch interessant.
Welche Dämmstoffe kommen bei der Innendämmung zum Einsatz?
Martin Brandis: Hier gibt es eine breite Palette. Häufig verwendet werden Mineralwolle, Holzweichfaserplatten oder poröse mineralische Dämmplatten. Wichtig ist, dass das Material zur gewählten Konstruktion passt und bauphysikalisch geeignet ist. Auch hier hilft die Beratung weiter, um individuelle Lösungen zu finden.
Warum ist ein feuchteschutztechnischer Nachweis so wichtig – und wie bekommt man ihn?
Martin Brandis: Bei einer Innendämmung besteht die Gefahr, dass warme Raumluft an der kälteren Außenwand kondensiert. Ein feuchteschutztechnischer Nachweis zeigt rechnerisch, ob dies kritisch wird oder nicht. Meist wird dieser Nachweis von Planungsbüros oder direkt von den beteiligten Fachunternehmen im Rahmen der Planung erstellt. Deshalb ist es wichtig, die Innendämmung nicht in Eigenregie umzusetzen, sondern qualifizierte Profis einzubeziehen.
Gibt Fördermöglichkeiten für die Innendämmung?
Martin Brandis: Im Rahmen der Bundesförderung für effiziente Gebäude – kurz BEG – können im Programmbereich Einzelmaßnahmen Zuschüsse für Einzelmaßnahmen zur Wärmedämmung von 15 Prozent der förderfähigen Kosten beantragt werden. Mit einem individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) kann die Förderung auf 20 Prozent erhöht werden. Eine Innendämmung wird in der Regel dann gefördert, wenn es sich bei dem Gebäude um ein Baudenkmal oder andere schützenswerte Bausubstanz handelt. Ebenfalls gefördert wird die Innendämmung von Außenwänden mit Sichtfachwerk. Bei anderen Wohngebäuden existieren für die Förderung höhere technische Mindestanforderungen, die häufig von der Innendämmung nicht erreicht werden.
Alle mit dem Zuschuss geförderten Maßnahmen können mit einem zinsgünstigen Ergänzungskredit der KfW finanziert werden.
Wärmedämmungen im Rahmen von Sanierungen zum Effizienzhausstandard können in der BEG, Programmbereich Wohngebäude mit zinsverbilligten Darlehen und Tilgungszuschüssen gefördert werden. Eine Sanierung zum Effizienzhausstandard ist sinnvoll, wenn neben der Außenwanddämmung weitere Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden sollen. In Effizienzhäusern müssen die Dämmmaßnahmen nicht die technischen Mindestanforderungen für Einzelmaßnahmen erfüllen.

Beratung sichert Qualität und schützt vor Problemen. Dank Fördermöglichkeiten wird die energetische Sanierung zusätzlich attraktiv.
Was raten Sie Hauseigentümer:innen, die über eine Innendämmung nachdenken?
Martin Brandis: Zunächst einmal: Lassen Sie sich beraten – am besten neutral und unabhängig. Die Energieberatung der Verbraucherzentrale bietet dafür ein umfassendes Angebot. Gemeinsam mit unseren Berater:innen lässt sich klären, ob eine Innendämmung technisch und wirtschaftlich sinnvoll ist, und welche Förderungen genutzt werden können.
Wo finden Interessierte weiterführende Informationen – auch ganz konkret zur Planung?
Martin Brandis: Unser Dämmatlas ist ein sehr guter Einstiegspunkt. Dort haben wir die wichtigsten Aspekte rund um die Dämmung kompakt und übersichtlich aufbereitet – inklusive Infos zu Materialien, Ausführungsvarianten und Förderungen. Und natürlich können Interessierte auch, bei offen gebliebenen Fragen, unsere regionalen Beratungsstellen kontaktieren.
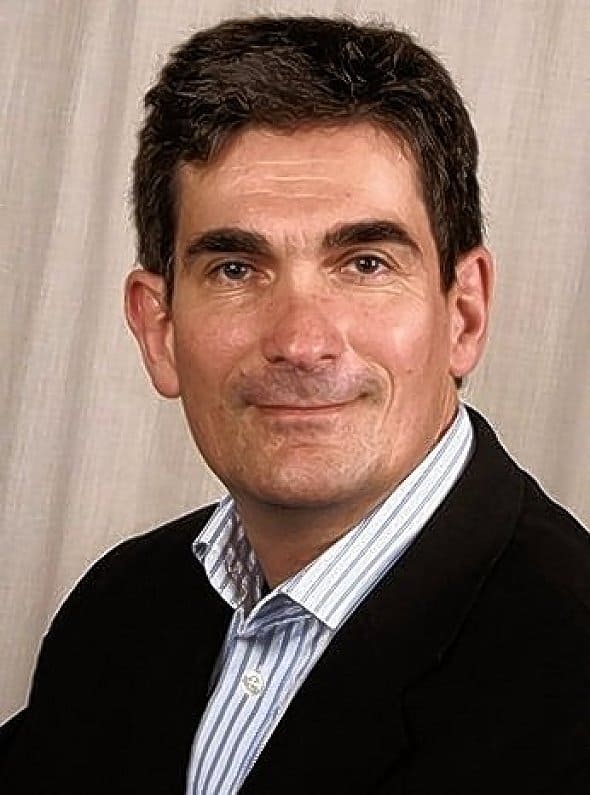
Martin Brandis
Energieberater und Fachreferent von der Verbraucherzentrale
Martin Brandis ist seit acht Jahren Fachreferent für Gebäudetechnik in der Energieberatung der Verbraucherzentrale. Zuvor arbeitete er 20 Jahre als Energieberater in der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.
Fotos: AdobeStock_Léna Constantin, AdobeStock_Ingo Bartussek, AdobeStock_Robert Kneschke, AdobeStock_contrastwerkstatt








